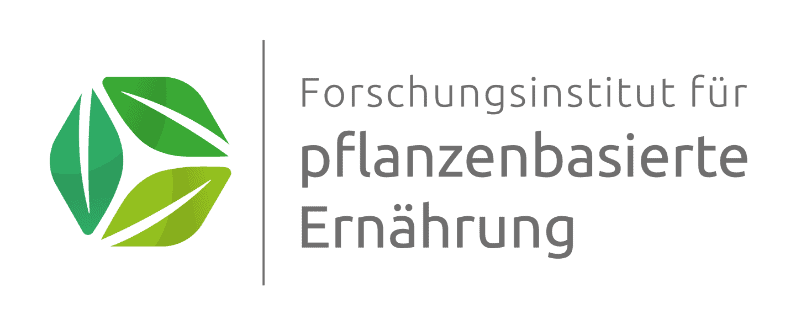Worum geht’s?
Die Nutritional Evaluation (NuEva)-Studie untersuchte, wie sich unterschiedliche Ernährungsweisen – omnivor, flexitarisch, vegetarisch und vegan – auf die Fettsäurezusammensetzung im Blut und entzündungsbezogene Biomarker auswirken. Grundlage war ein Parallelgruppen-Design, in dem Screening-Daten analysiert wurden.
Hintergrund
Ernährungsgewohnheiten beeinflussen das Fettsäureprofil im Blut, das eine wichtige Rolle für Stoffwechsel, Zellfunktionen und Entzündungsprozesse spielt. Pflanzenbasierte Ernährungsformen, insbesondere die vegane Ernährung, schließen tierische Quellen langkettiger Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) aus. Dadurch kann die Versorgung mit diesen Fettsäuren geringer ausfallen – was langfristig Entzündungsprozesse oder Herz-Kreislauf-Risiken beeinflussen könnte.
Methodik
Teilnehmende wurden vier Ernährungsgruppen zugeordnet, denen sie seit mindestens einem Jahr angehörten. Die Einhaltung wurde über Interviews und Ernährungstagebücher überprüft.
Zu Studienbeginn erfassten Forschende die Nährstoffaufnahme über ein fünftägiges Ernährungsprotokoll. Zusätzlich wurden Blut-, Urin- und Stuhlproben entnommen sowie Körperzusammensetzung und Vitalparameter gemessen.
Die Analyse konzentrierte sich auf Unterschiede in der Aufnahme und im Blutstatus von Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Dafür wurden Fettsäureprofile aus Plasma und Erythrozyten bestimmt und Entzündungsmarker analysiert.
Ergebnisse
- Gesättigte Fettsäuren (SFA):
Veganer zeigten signifikant niedrigere Anteile gesättigter Fettsäuren im Plasma – erklärbar durch den Verzicht auf tierische Produkte, die Hauptquellen dieser Fette sind. - Einfach ungesättigte Fettsäuren (MUFA):
In der veganen Gruppe fanden sich höhere MUFA-Konzentrationen in den Erythrozyten. Dies könnte mit einem erhöhten Verzehr von pflanzlichen Ölen wie Olivenöl oder Rapsöl zusammenhängen, die reich an Ölsäure sind. - Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure):
Die Aufnahme von Linolsäure war bei Vegetariern und Veganern signifikant erhöht. Ein möglicher Grund hierfür ist der häufige Konsum von Nüssen, Saaten und pflanzlichen Ölen, die hohe Mengen an Omega-6-Fettsäuren enthalten. - Arachidonsäure (AA):
Omnivore Teilnehmer zeigten die höchsten Werte an Arachidonsäure in den Erythrozyten. Dies steht im Einklang mit dem höheren Konsum tierischer Produkte, die AA direkt enthalten. - Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA):
Bei Veganern wurde ein deutlicher Rückgang von EPA und DHA festgestellt. Da diese langkettigen Fettsäuren fast ausschließlich in Fisch und Meeresfrüchten vorkommen, ist der Rückgang auf das Fehlen dieser Nahrungsmittelquellen zurückzuführen. - Omega-3-Index:
Der Omega-3-Index, ein wichtiger Indikator für die Versorgung mit EPA und DHA, war bei Veganern am niedrigsten. Dieser Befund unterstreicht das potenzielle Risiko einer unzureichenden Versorgung bei rein pflanzlicher Ernährung. - Entzündungsmarker:
Zwischen den Gruppen konnten keine signifikanten Unterschiede bei klassischen Entzündungsparametern (z. B. IL-6, TNF-α, hsCRP) festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass verschiedene Ernährungsformen nicht zwangsläufig mit einem erhöhten systemischen Entzündungsniveau einhergehen. - Leptin:
Die Leptinwerte waren in der veganen Gruppe signifikant niedriger. Dieser Effekt könnte mit dem geringeren Körperfettanteil und der insgesamt niedrigeren Energiezufuhr in dieser Gruppe zusammenhängen.
Fazit
Die Ernährungsweise hat einen deutlichen Einfluss auf das Fettsäuremuster im Blut. Pflanzenbasierte Ernährungsformen zeichnen sich durch niedrigere Werte gesättigter Fettsäuren und höhere Anteile an Omega-6-Fettsäuren aus, gehen jedoch mit einer deutlich geringeren Versorgung an langkettigen Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA) einher.
Trotz dieser Unterschiede zeigten sich keine signifikanten Veränderungen bei Entzündungsmarkern, was darauf hinweist, dass verschiedene Ernährungsformen bei gesunden Personen nicht zwangsläufig zu erhöhter systemischer Inflammation führen.
Langfristig könnte der niedrige Omega-3-Index bei Vegetariern und Veganern jedoch relevant sein, da EPA und DHA wichtige Funktionen für Herz-Kreislauf- und Gehirngesundheit erfüllen.
Um die langfristigen gesundheitlichen Folgen dieser ernährungsbedingten Verschiebungen im Fettsäureprofil besser zu verstehen, sind weitere Studien erforderlich.
Der vollständige Artikel ist unter diesem Link abrufbar.
Klein L, Lenz C, Krüger K, Lorkowski S, Kipp K, Dawczynski C (2025) Comparative analysis of fatty acid profiles across omnivorous, flexitarians, vegetarians, and vegans: insights from the NuEva study. Lipids Health Dis. Apr 9;24(1):133. doi: 10.1186/s12944-025-02517-6.